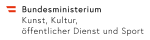MITGLIEDER
Text von:Bastian Schneider
Auszug aus: Vom Winterschlaf der Zugvögel
Orthokratie
Den Vogel abzuschießen habe ich früh gelernt. Ich war noch keine zehn Jahre alt und brauchte dafür kein Gewehr. Aber es war keine Ehre dabei. Die Vögel fielen herunter und wurden vom schwarzen Einband meines Deutschhefts begraben. Darin lagen Diktate, in denen die Fehler sich bald zu Feldherren und Diktatoren mauserten und das, was Recht geschrieben war, bedrohten. Hörig nur dem Kinderohr, das seine eigenen Regeln weitergab an die kleine Hand, die im Verlauf der Zeilen immer kleiner wurde. Wer wollte hier Unrat von Unrecht unterscheiden? Der Unterricht danach blieb Nacht. Hier herrschte eine Eule, die noch jede Feder las. Mit den Fehlern hielt sie eine Fehde, die ein Blutbad hinterließ. Die schönen falschen Wörter – das Mamor, der Maßt, die Maschiene – lagen massenweise massakriert auf den Seiten. An den Rändern stand eine Armee feuerrot Spalier und drohte: R und R und immer wieder R. Ein Buchstabe, der sich mir wie eine Schlinge um den Hals legte, die immer enger wurde. In seiner konsonantischen Kleinlichkeit konspirierte das R mit der Eule, sie sprachen kongenial das Urteil über mich: Mangelhaft! Mein Heft, ein toter Vogel, lag vor mir aufgeschlagen und erwürgt auf dem Tisch. Aber ich wollte die Schuld daran nicht haben, zumal mir der Name der Eule, meines Lehrers Dr. Schütz, verdächtig war.
Tagtraum einer Hosentasche
Meine einzige Begegnung mit einem Pinguin hatte ich auf einem der vielen Spaziergänge entlang des Flusses, der in unserer Ortschaft, dort, wo er unter dem Betondach der Stadtautobahn hervortritt, durch ein kleines Industriegebiet führt. Hier ging ich oft mit meinen Großeltern am Ufer spazieren, hier brachte mir mein Opa bei, wie man Steine übers Wasser flitschen läßt. Einmal grub ich zwischen kleineren Flußsteinen und Kieseln einen handflächengroßen, glattgewaschenen Stein aus, der sich nach der einen Seite hin zu einem Schnabel verjüngte. Die Flügel zur anderen Seite hin angelegt und seine Füße nach dem Absprung gestreckt, war sein Körper scheinbar eingetaucht. Doch der kurze hüpfende Flug übers Wasser und das Bad danach, blieben an diesem Tag anderen Vögeln vorbehalten. Der Pinguin verschwand in den Untiefen meiner Hosentasche. Zusammen mit einem Hirsch aus Blei und allerlei hölzernem Getier, das eine Kinderhand greifen kann, gräbt er da unten ein Loch, das niemals groß genug sein wird, um sich für immer zu befreien.
Duffeln
Zwei Polizisten winken mich an den Straßenrand und fragen nach meinen Papieren, die ich ihnen umgehend aushändige. Damit geben sie sich jedoch nicht zufrieden und fordern mich auf, auszusteigen. Schon stehen wir zu dritt vor dem geöffneten Kofferraum meines Wagens. Was ist das? fragt einer der Polizisten erstaunt. Duffeln, höre ich mich sagen. Als ich aber in den Kofferraum schaue, liegt da anstelle der Kartoffeln ein Dutzend Tauben in einem Sack zusammengepfercht, lebende Tauben. Ihr Gurren übertönt die Worte der Polizisten, einzig das Wort beschlagnahmt kann ich verstehen. In diesem Moment bemerke ich, daß eine der Tauben die groben Maschen des gelben Kartoffelsacks mit ihrem Schnabel aufgetrennt hat. Schon fliegen sie eine nach der anderen heraus. Die Polizisten, die sich synchron die Lippen lecken, zücken ihre Pistolen und schießen hinter den Tauben her. Ohne Erfolg, die Tauben steigen immer höher und kreisen bald über unseren Köpfen. Wir müssen Sie mitnehmen, sagen die Polizisten im Chor. Meine Erklärungsversuche, es gäbe eine Taubenart, deren Eier wie Kartoffeln aussehen, wie Duffeln, und ich hätte diese mit Taubeneiern verwechselt, Studien darüber gäbe es und über Verwechslungen wie diese hier, ich selbst sei auf dem Gebiet bewandert, gewissermaßen eine Koryphäe, ein Kapazunder der Kartoffeltaubenforschung, wenn sie mich nur an mein Handschuhfach lassen würden, mein Dienstausweis, eine bedeutende Urkunde lägen zum Beweis darin, sogar meine Doktorarbeit über den sogenannten gemeinen Taubling – meine Erklärungsversuche schießen sie mit ihren Pistolen in den Wind und machen sich daran, mich in den leeren Kartoffelsack zu stecken. Da aber stürzen die Tauben wie Falken vom Himmel, schlagen mit ihren Flügeln und Schnäbeln auf die Polizisten ein, packen mich bei den Schultern und tragen mich Richtung Vollmond davon.
Über das Mogeln
Kein Tier ist schwerer zu malen als ein Vogel. Hunderte übereinander liegender Schichten von Federn getreu abzubilden, abertausende ihrer feinen Lamellen einzeln nachzuziehen, die Farben, die Myriaden ihrer Nuancen und Schattierungen exakt zu erfassen und seien sie alle schwarz. Es wäre Wahnsinn und Traum, und doch – kein Tier ist leichter zu malen als ein Vogel. Dem Kind genügt ein mit weichen Bögen flach geschriebenes M und schon fliegt da einer, eine Krähe wahrscheinlich; ich höre ihr Krächzen. Das M bleibt aber ein M und ist nur zugleich ein Vogel als auf den Kopf gestellte Welle. Dann muß es eine Möwe sein. Sie mag das Vorbild abgegeben haben für all die Ms, die seit der Kindheit über unsere Blätter geflogen sind. Noch heute sieht man Möwen über dem Meer hängen wie ein M, wie eine Welle, die unter ihnen ahnungslos vorbeizieht. Wer macht hier wen nach? Wie macht sich das M zum Vogel, der Vogel zur Welle und die Welle wieder zum M? Hier mogelt doch einer wogenhoch – wir suchen das Leichte und wollen Vögel sein über dem Meer, indem wir Wellen schreiben. M und M und immer wieder M. Ein ganzer Schwarm mit einem Federstrich.
Über das Schwindeln
Beim Karussell-Fahren winkt die Mutter vom Rand in die bewegte Welt der erstarrten Bilder und Pferde, in der das Kind zum Herrscher wird. Hier gerinnt Geschichte zum Spiel. Die Pferde haben einmal gelebt: Beim Ringelstechen trugen sie den Reiter treu ans Ziel. Nicht weniger treu sind sie jetzt gebändigt in der Mechanik des Apparats, der statt eines Ziels nur noch einen Zweck hat – zu kreisen. Die leiernde Musik spielt den Trauermarsch dazu, das Kind lacht seiner Mutter entgegen. Nach dem Absteigen müssen sich die Beine wieder an den Boden gewöhnen, das Karussell wird zum unsicheren Grund.
Das Kettenkarussell hat nicht einmal mehr diesen. Es ist ein zweifelhaftes Luftgeschäft. Die Lust an der Gefahr und alle schauen zu. In hundert Metern Höhe gibt es hier für fünf Euro vier Minuten unter drei goldenen Uhren. Man sitzt zu zweit nebeneinander, aber die Angst macht einen einsam. Hier gibt es keine dienstbaren Tiere mehr, und der Wind in den Ohren ist die einzige Musik. Anstelle der Mutter steht jetzt nur noch der Mut am Rand. Je höher man fährt, desto kleiner wird er. Ein letztes Winken. Wie schön war‘s noch am Boden, fester Grund unter den Füßen und ich wußte, von wo ich gekommen war und wohin ich gehen wollte. Hier oben verschwimmen die Himmelsrichtungen zu einer einzigen, und die heißt Hoffnung. Die Hoffnung darauf, die Kette möge halten. Tut sie es nicht, bin ich zwar frei, aber es ist die Freiheit zum Tode. Ob ich den Aufprall noch spürte? Ob ich meinen Sturzflug auf die Baumgruppe da unten lenken könnte? Es sind schon Menschen aus Flugzeugen gefallen und haben überlebt. Aber der Gegenwind dreht den Sitz immer an der gleichen Stelle. Er läßt keinen Zweifel daran, daß ich an der Kette vorerst besser aufgehoben bin. Ich halte mich an ihr fest, wie meine Nachbarin die Augen geschlossen. So sind wir beide gefangen in einer Nähe, die aus der Ferne so frei und leicht aussah. Das Bild hat uns getäuscht, wir haben die Seiten getauscht und geben es nun selbst ab. Auf dem Weg nach unten und zurück ins Leben hängen wir reglos. Wir sind noch einmal davongekommen. Die Kette ist mir in die Glieder gefahren. Was durch die Fliehkraft eben noch gespannt nach oben drängte, sackt jetzt träge nach unten. Vom Mut ist nur der Ruf nach der Mutter geblieben.
Über das Irren
Für Marie
Eines der schönsten Geschenke, das ich jemals bekommen habe, ist ein Mobilé. Ich bekam es zu irgendeinem zwanzigsten Geburtstag. Seitdem begleitet es mich von Wohnung zu Wohnung und hängt jetzt in meinem Zimmer direkt unter der Vogelkäfiglampe. So läßt es sich sowohl vom Schreibtisch als auch vom Bett aus beobachten. In seiner wundervollen Nutzlosigkeit manifestiert sich, was Kant mit dem interesselosen Wohlgefallen gemeint haben mag: Das Mobilé ist schön. Es besteht aus drei Schiffen, ein größeres wird von zwei kleineren ausbalanciert. Es sind Wikingerschiffe aus Teakholz mit Drachenköpfen am Bug und weißen Rahsegeln. Ein leichter Luftzug versetzt sie in Bewegung. Wenn Tür und Fenster geschlossen sind, treiben die Schiffe ruhig dahin. Das Bettenmachen dagegen bringt sie in Seenot. Im Sommer liege ich während der Mittagspause oft auf meinem Bett und beobachte, wie sich einige Stubenfliegen um die begehrten Plätze an Bord der Schiffe streiten: ein Luftkampf auf hoher See, der mich einschläfert.
Das Land meiner Träume seit frühester Kindheit war Amerika. Es lag in unermeßlicher Ferne und ein Meer zwischen uns – Amerika. Der Name geht auf Amerigo Vespucci zurück, einen florentinischen Seefahrer. In seinem Mundus Novus genannten Reisebericht von 1502 spricht er als erster davon, daß die neue Welt ein eigenständiger Kontinent sei. Der elsässische Dichter Matthias Ringmann las den Bericht, glaubte, Vespucci habe den Kontinent entdeckt und nannte ihn Amerika. Auf der mit dem Kartographen Martin Waldseemüller 1507 gestalteten Weltkarte taucht der Name zum ersten Mal auf, und obwohl Kolumbus als der wahre Entdecker gilt, sprach alles von Amerika. Was aber bleibet, stiften die Dichter, auch wenn sie irren. Ein noch schönerer Irrtum wäre es gewesen, hätte Waldseemüller seinen Namensvorschlag durchgesetzt – Papageienland.
Dorthin aber sollte man fliegen, werden sich die Wikinger gedacht haben, als sie nach langer Schiffsreise noch vor Kolumbus in Amerika landeten. Wie schon in Asterix und die Normannen geschrieben steht, suchten sie dort die Angst, die bekanntlich Flügel verleiht. Sie haben sie gefunden. Wie anders als im Fluge hätten sie es sonst nach Asien geschafft, wo sie das Teakholz für ihre Schiffe gefunden haben? Wovor sie Angst hatten, bleibt ihr Geheimnis. Vor den Vereinigten Papageien von Amerika oder davor, nicht mehr zurückzufinden? Ihre Odyssee geht weiter und ihr Klagelied weckt mich aus meinem Mittagsschlaf – ein untrügliches Summen.
Über Stock und Stein
Als Kind war der Boden mein Himmel. Das Schönste daran: Ich konnte ihn immer erreichen. Je kleiner ich war, desto leichter kam ich an ihn heran. Hier kannte ich mich aus, im Reich der Stöcke und Steine. Wie die sich unter meinen Augen verwandelten! Und hielt ich sie erst in der Hand, war ihnen eine neue Form gegeben. Die Wörter, mit denen ich sie aufhob, machten uns miteinander bekannt – den Pinguin, den Hirsch und mich. Je nachdem wie ich den Hirsch drehte, wurde er zu Amerika, der Pinguin hob als Rakete zu den Sternen ab. Vielleicht war das der erste Schritt weg vom Boden. Ich lag auf der Wiese im Garten und verfolgte die Wolken bis zur Kenntlichkeit. Näher bin ich dem Himmel nie gekommen. Heute ist vielleicht er mein Boden. Das Schönste daran: Ich gelange nie bis an sein Ende. Ich suche ihn ab nach lesbaren Zeichen. Werfe ich meine Wörter in die Luft, fallen sie herunter wie Steine und Stöcke. Während ich sie aufklaube, verwandeln sie sich unter der Hand. Ich traue meinen Augen nicht mehr. Kennen wir uns? Was heißt eigentlich Amerika? Ich sehe den Himmel vor lauter Raketen nicht, oder sind das Wolken?
Verwandlung
Carl von Linné glaubte, daß sich die Schwalben im Winter in die Sümpfe zurückziehen, um dann im Frühling als Amphibien wieder aufzutauchen. Ich stelle mir diese Schwalben gerne vor: Im Sommer durchtrennen sie die Maschen der Luft mit ihrem Fiepen und ihren scharfen Flugbahnen. Sie stürzen sich von den Mauern in die Tiefe, ebenso schnell schwingen sie sich wieder nach oben, unter einen Dachfirst, wo sie sich durch ein Nadelöhr in ihr Nest zwängen. Das Geräusch, das ihre Flügel dabei machen – ein mattes Rascheln. Weiter im Flug und weiter im Jahr, noch ein wenig Herbst zerschneiden. Und mit dem fallenden Laub fallen auch langsam die Schwalben zu Boden. Sie haben ihre Schnelligkeit verloren, ihre Flinkheit und Clownerie waren dem Scheinwerferlicht des Sommers vorbehalten. Der Novemberregen und die Schritte der Passanten zermalmen das Laub auf den Gehwegen und Straßen zu einem braunen Morast, der die Rinnsteine verstopft. Die gefallenen Schwalben halten sich in den Gebüschen versteckt, eingeschlagen ins Laub, und so vermummt kriechen sie nun in die nahe gelegenen Sümpfe. Bald wird Schnee alles bedecken. Aber dann sind die Schwalben bereits vollkommen verpuppt. Nichts stört diesen Winterschlaf der Zugvögel, die schon keine Vögel mehr sind. Sie haben ihre Flügel abgelegt und sind weiter gezogen. Unter dem Panzer verklebter Federn bildet sich eine neue Haut.
Quelle: Auszug aus: „Vom Winterschlaf der Zugvögel“ von Bastian Schneider
©Sonderzahl Verlag Wien, 2016