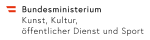MITGLIEDER
Text von:Linda Stift
Die geborgte Krankheit
Ihren Namen weiß ich nicht mehr, nur den ihrer Krankheit: Leukämie. Sie ist daran gestorben, im Bett, das neben meinem stand, ich war fünf und sie vielleicht drei oder vier Jahre älter. Ich sah sie immer nur liegend neben dem Gestell für ihre Infusionsflasche oder auf dem Weg ins Badezimmer, von einer Krankenschwester gestützt, sie sprach nicht mit mir. Manchmal saß ihre Mutter neben ihr, ihre Verzweiflung füllte das Zimmer bis zum letzten Winkel. Das Mädchen konnte oder wollte nicht mit mir sprechen, wir schlossen keine Freundschaft, wie es vielleicht die Verantwortlichen, die uns dasselbe Zimmer zugeteilt hatten, gerne gesehen hätten. Vielleicht dachte sie, es zahlt sich nicht mehr aus. Vielleicht war ich ein reines Ärgernis für sie mit meinen langen braunen Haaren, die mir eine Krankenschwester in der Früh bürsten half. Eine Verhöhnung ihres kahlen Kopfes. Wahrscheinlich aber kam ich in ihren Überlegungen gar nicht vor. Ihr Gesicht war grau und sehr teigig, und eines Morgens war sie nicht mehr da und kam auch nicht wieder. Ich hatte nichts bemerkt. Über ihr Fortsein wurde ich nicht aufgeklärt – zumindest habe ich keine Erinnerung daran -, aber dass sie weder entlassen noch in eine andere Abteilung verlegt worden war, das wusste ich auch so.
Ich hatte „nur“ eine Nierenentzündung, eine ernsthafte Krankheit zwar, doch eine, bei der man im Allgemeinen nicht plötzlich verschwindet (nur meine Mutter wusste von einem Nierenkranken zu berichten, der starb, nachdem er eine 1-Liter-Flasche Mineralwasser ausgetrunken hatte). Ich verbrachte insgesamt zwei Monate in der Grazer Kinderklinik, anscheinend die kürzest mögliche Zeit, in der eine Nierenentzündung ausgeheilt werden kann. Mein Vater erzählt mir heute, dass es Leute gibt, die ein Jahr lang in Behandlung sind. Ich bin entsetzt. Er erzählt mir auch, dass ich „gefremdelt“ hätte, wenn er und meine Mutter mich besuchten. Ich sei ihnen gegenübe abweisend gewesen, und wenn sie mich fragten, ob ich etwas brauche oder mir etwas Besonderes wünschte, sagte ich immer sehr höflich „Nein, danke“, so als ob ich mit ihnen „fertig gewesen“ sei. Das war sein Eindruck. Ich hätte mich auch nie über etwas beklagt, hätte alles „mit mir alleine“ ausgemacht. Ich hingegen kann mich an einen kulinarischen Wunsch erinnern, den ich offenbar doch äußerte, etwas makaber scheint mir das jetzt. Ich wollte unbedingt einmal gebratene Nierndln mit Reis essen, ein Leibgericht meiner Kindheit, aber es schmeckte im Krankenhaus so scheußlich (weil gänzlich ohne Salz zubereitet), dass ich es nicht herunterbrachte, was mir von Seiten des Krankenhauspersonals wiederum als Undankbarkeit ausgelegt wurde.
Hin und wieder bekam ich Infusionen, und einmal sogar eine Bluttransfusion, was mir ein grandioses Gefühl der Bedeutung vermittelte. Mein Vater, der mich gerade besuchen wollte, und durch die Glasscheibe meinen kleinen blassen Handrücken auf der Bettdecke sah, in dem eine Infusionsnadel steckte, fing an zu weinen und musste sich erst wieder beruhigen, bevor er zu mir ins Zimmer kommen konnte. Ich litt unter Anämie, das dauernde Liegen, die salzlose Diät, wenig frische Luft und vielleicht auch der Schock, von einem Tag auf den anderen von meinen Eltern getrennt zu sein, zehrten an mir. Damals war es ja noch nicht üblich, dass zumindest ein Elternteil rund um die Uhr bei seinem kranken Kind sein konnte.
Eine Woche verbrachte ich laut Auskunft meines Vaters auf der Quarantänestation in einem anderen Gebäude, in meiner Erinnerung sind es zwei oder drei Wochen. Jemand hatte mich mit Mumps angesteckt, ich sah aus wie ein Hamster, der sich die Backen vollgestopft hat. Dort war ich mit zwei älteren Buben in einem Zimmer, die mir täglich mit einer Rückenmark-Entnahme drohten, vermutlich, weil das bei ihnen gemacht worden war. Ich könne mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich weh das täte, außerdem sei man danach für immer gelähmt. Jeden Morgen wartete ich nun darauf, dass man mich abholte, um mich für immer zu lähmen. Meinen Eltern sagte ich davon nichts, wenn ich es ihnen erzählte, sagten die beiden, würden sie einfach behaupten, ich lüge. Auf die Idee, dass meine Eltern mir eher glauben würden als zwei fremden Buben, kam ich offenbar nicht.
Als ich wieder auf die normale Station kam, legten sie mich in ein größeres Zimmer, mit sechs (oder acht?) Betten, es war angenehmer mit mehreren Kindern, obwohl ich mich an kein einziges erinnere.
[...]
In späteren Jahren behauptete ich oft meinen Schulkollegen gegenüber, ich hätte einmal Leukämie gehabt, Anämie oder Leukämie, der sprachliche Unterschied schien nicht allzugroß, aber dass Leukämie gefährlicher war, wusste ich nun aus eigener Erfahrung. Ich ging mit einer geborgten Krankheit hausieren, um mich wichtig zu machen, und ich wurde tatsächlich bestaunt, als ob ich etwas Großartiges geleistet hätte. An das Mädchen selbst dachte ich gar nicht mehr oft, nur das Wort Leukämie übte eine seltsame Faszination auf mich aus, es war mir vertraut. Wenn jemand von einem leukämiekranken Menschen erzählt, sehe ich immer dieses graue, teigige und stumme Gesicht vor mir, das mir nichts mitteilen wollte.