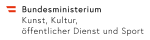MITGLIEDER
Text von:Bernhard Strobel
Textauszug aus: Der gute Mann Leidegger
Auf der Rückfahrt von Kamilla hielt Leidegger vor einem Wirtshaus an. Er hatte noch ausreichend Zeit nach seinem dunklen Davongehen, und er verspürte große Lust, ein Bier zu trinken. Jedes Mal, wenn er von Kamilla zurückfuhr, kam er an diesem Wirtshaus vorbei. Es lag auf halber Strecke zwischen ihrem Haus und der Werkstatt und sah mittelmäßig heruntergekommen aus, ein durchschnittliches Wirtshaus in einem durchschnittlichen Ort. Die Fensterscheiben milchig verschmiert und halb mit vergilbten, rustikalen Häkelgardinen verhängt, die Fassade war ausgeblichen und hatte an vielen Stellen großflächig Blasen geworfen, bei denen Leidegger sich wunderte, weshalb sie nicht längst aufgeplatzt waren und das darunterliegende Mauerwerk freigelegt hatten. Er war noch nie eingekehrt, weil er fast nie ins Wirtshaus ging. Er war kein Mann, der zum Biertrinken ins Wirtshaus ging, weil er so ein Mann nicht sein wollte. Die Glanzzeit der Wirtshäuser war entschieden vorbei und damit zwangsläufig auch die der darinsitzenden Männer. Am Wirthaustisch beim Kartenspiel über Sport und Politik reden und währenddessen ein Bier nach dem anderen kippen – die bloße Vorstellung ließ ihn den Kopf schütteln. Jetzt wollte er so ein Mann sein, aber nicht einmal dazu schien er mehr fähig, ohne sich von einer unsichtbaren moralisierenden Instanz beobachtet und bewertet zu fühlen. Nichts, so kam es ihm vor, konnte noch von ihm getan werden, das nicht gleichzeitig die Gedanken über dieses Tun im Schlepptau hatte. Nie wurde er das unangenehme Gefühl los, bei allem, was er tat, von einer übergeordneten Warte aus observiert und analysiert zu werden, einem alles sehenden Auge, das pausenlos nach Fehltritten Ausschau hielt, die vor dem großen Moralgericht gegen ihn ins Treffen geführt werden konnten. Zum Biersaufen ins Wirtshaus wie in der Zeit der alten Patriarchen – und der zitternde Zeiger des Moralometers zuckt einen Schritt vorwärts. Was zum Teufel war sein Problem? Er brachte es nicht über sich, auszusteigen und in diesem Wirtshaus ein Bier zu trinken, weil er wusste, er würde dort nicht als ein Mann sitzen, der in einem Wirtshaus ein Bier trank, sondern als einer, der ständig vor Augen hatte, dass er als Mann in einem Wirtshaus ein Bier trank, der es real tat und geistig zugleich, der es wollte und gleichzeitig nicht wollte. Würde er jetzt dieses Lokal betreten, dann würde er es als jemand tun, der bereits ein drittes Stadium erreicht hatte. Erstes Stadium: Ein Mann geht in ein Wirtshaus und trinkt Bier. Zweites Stadium: Ein Mann geht nicht mehr zum Biertrinken ins Wirtshaus, weil er kein Mann sein will, der in einem Wirtshaus ein Bier trinkt. Drittes Stadium: Ein Mann geht zum Biertrinken ins Wirtshaus, will kein wirtshausgehender Mann sein, geht aber trotzdem. Er konnte nicht einfach ins Wirtshaus gehen, er konnte nur trotzdem gehen. Und wenn er sich jetzt entschloss, doch nicht zu gehen: Ginge er dann nicht oder ginge er trotzdem nicht? Existierte sogar schon ein viertes Stadium? In was für einen verflixten Zustand war eine Welt geraten, in der ihm so ein sich selbst multiplizierendes Denken auferlegt wurde. Das Trotzdem war bei ihm zum Grundzustand geworden. Er war nur trotzdem Fotograf, hatte nur trotzdem Haus und Garten, nur trotzdem Ehefrau und Kind, nur trotzdem eine Affäre. Es schien ihm, als ob es überhaupt nichts Natürliches mehr gäbe. Nichts Unreflektiertes, nur Überreflektiertes und Zerreflektiertes. Wenn er in einem Magazin Haus und Garten abgebildet sah, weil darin vom großen Wunsch vom Eigenheim mit Garten berichtet wurde, verlor er für eine Weile die Lust an seinem eigenen Haus und Garten, weil er nicht mehr wusste, ob die Fotos oder sein Wunsch zuerst da waren. Wenn er den Geschlechtsverkehr praktizierte oder nur daran dachte, war ihm die eigene Geilheit zuwider oder baute sich gar nicht erst auf, weil sich das Triebhafte nicht mehr wohltuend triebhaft, sondern wie eine tausendfach wiederholte Sexszene anfühlte. Wenn irgendwo Werbung für etwas gemacht wurde, dachte er sofort: Ah, Werbung, ich werde beeinflusst. Doch damit war es nicht getan, denn es gab ja längst Werbung für Werbung: »Jetzt kommt die Werbung« … »Nur 15 Sekunden Werbung« … »Hier ist Platz für Ihr Werbeplakat«. Dass das überhaupt noch funktionierte! Dass dieses bis in alle Ecken und Winkel durchschaute Kartenhaus nicht längst eingestürzt war! Aber das Gegenteil war der Fall: Weil die Werbung unsterblich war, gab es das Beeinflussen jetzt als Beruf. Bitte nur ein einziges Mal wieder unbemerkt manipuliert werden! Einen Schokoriegel kaufen ohne den hundertmal gehörten Werbetext im Ohr! Oder wenn Wahlen stattfanden und die Mitglieder der politischen Parteien im Fernsehen auftraten, dann wurde der Auftritt direkt im Anschluss von einer Fachperson wissenschaftlich analysiert, worauf die Menschen daheim vor dem Fernseher die Analyse analysieren durften. Im Internet konnte man sich Videos von Menschen ansehen, die sich Videos ansahen, bald vermutlich von Menschen, die sich Videos von Menschen ansahen, die sich Videos ansahen. Der Titel eines Buches fiel ihm ein: … trotzdem Ja zum Leben sagen, und sofort drangsalierte ihn das schlechte Gewissen. Da es in dem Buch um die Hölle der Konzentrationslager ging, glaubte er, sein eigenes Leiden, sein eigenes Trotzdem, dürfe nicht ins Gewicht fallen. Leider tat es das aber.