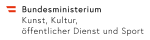MITGLIEDER
Text von:Britta Mühlbauer
Was wir nicht voneinander wissen (Anfang)
Wir begegnen einander täglich am späten Nachmittag auf dem Platz. Die eine kommt vom Büro nach Hause, der andere kehrt mit seinem Kumpel vom Deutschkurs zurück. Der Bürgersteig ist schmal. Wir gehen aneinander vorbei und richten den Blick auf die Grünanlage im Zentrum des Platzes, auf Blätter im Rinnstein oder die Häuser, an denen wir entlang gehen. Es scheint uns nicht angebracht, einander in die Augen zu sehen. Die eine wohnt in dem himmelblauen Haus am Platz, der andere in der Asylunterkunft um die Ecke.
Wir sind beide fremd hier. Die eine ist erst vor kurzem in das himmelblauen Haus gezogen. Sie hat sich getrennt und lebt nun allein. Sie muss sich noch daran gewöhnen, dass ihr keiner zuhört, wenn sie nach Hause kommt. Sie schaltet das Radio ein und manchmal redet sie mit sich selbst. Hört ja niemand.
Der andere hat einen langen Weg hinter sich. Seine Kleider sind aus zweiter Hand. Seine Familie hat ihn in die Fremde geschickt, damit er in Sicherheit ist. Er kann sich nicht an den Gedanken gewöhnen, sie nie wieder zu sehen. Er hofft, dass alles gut wird. Das kann ihm niemand verbieten.
Die Asylunterkunft betrachten wir beide mit gemischten Gefühlen. Die eine hat Decken und Kissen gespendet. Das Bettzeug erinnerte sie an früher, es ist gut, dass es aus dem Haus ist. In der Unterkunft sind Familien und unbegleitete Jugendliche untergebracht. Die Männer zeigen sich auf der Straße, Frauen und Mädchen bleiben unsichtbar. Das ärgert sie.
Der andere wacht jede Nacht auf, sein Herz trommelt, er drückt das Gesicht ins Kissen, damit niemand hört, wie er weint. Er ist in Sicherheit und hat einen Freund gefunden. Gemeinsam vertreiben sie sich die Zeit, reden über die Heimat, fahren durch die Stadt und lassen abweisende Blicke an sich abperlen. Zu zweit geht das leichter.
Obwohl wir uns nicht ansehen, wenn wir uns auf dem Platz begegnen, erkennen wir etwas wieder. Die eine erinnert sich an ihren Neffen: die gebeugten Schultern („geh aufrecht“), die schüchterne Neugier. Der andere hatte eine Halbschwester, von der es hieß, sie sei eine Hure. Sie wohnte alleine in einem Vorort, empfing gerne Besuch und redete über Männersachen: Politik, Religion und wie man einen Gasherd repariert. Auf der Straße hatte sie ihre eigene Methode, sich alles anzusehen, während sie die Augen gesenkt hielt. Das war vor dem Krieg.
Wenn wir einander auf dem Platz begegnen, gehen wir zügig aneinander vorbei. Wir trödeln nicht. Eines Vormittags allerdings sitzt die eine auf einer Bank in der Grünanlage. Sie hat Urlaub und keine Ahnung, wie das gehen soll, allein. Sie blickt zu den Fenstern ihrer Wohnung hoch. Hier fühlt sie sich fremd genug.
Sie hat sich einen Donut gekauft. Das hellbraune flauschige Schmalzgebäck liegt auf einer Papiertüte auf ihrem Schoß. Donut, do not, seltsame Gedanken in einem untätigen Kopf. Die Kristallzuckerkruste glitzert. Wie die Zuckerkristalle zwischen den Zähnen knirschen werden!
Der andere ist an diesem Vormittag alleine unterwegs. Sein Freund hat Geburtstag. Er liegt auf dem Bett und telefoniert mit der Familie. Er sagt, es habe keinen Sinn, zu bleiben. Er werde zurückkehren, auch wenn ihn das das Leben koste. Solche Gedanken gehen auch dem anderen durch den Kopf, wenn er Zeit totschlagen muss. Zu Hause sterben Menschen, Verwandte, Freunde und er kann nichts tun als warten. Er wartet und hofft, dass irgendwann irgendwo irgendjemand entscheidet, dass der Alptraum endet.
An einem Vormittag haben wir nicht miteinander gerechnet. Die eine lässt den Donut sinken, von dem sie soeben kosten wollte. Der andere bleibt stehen.